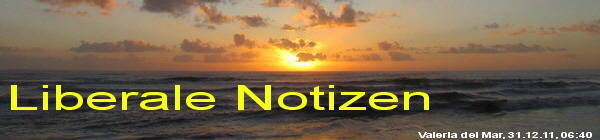
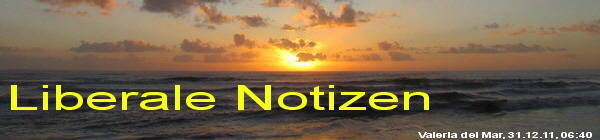 |
|
Gesellschaft |
|
|
|
|
17.06.25 / 28.12.20 / 18.03.20 / 27.01.20 / 24.11.19 / 16.12.18 / 19.02.18 / 18.08.17 / 22.01.17 / ... / 18.01.03
Gesellschaft, Absicht einer Definition Alle Menschen? Einige Menschen? Ein Mensch? Letzteres nicht. Wie viele Menschen wird offen bleiben. Nach GABLER WIRTSCHAFTSLEXIKON, 14. Auflage, Wiesbaden 1997, hochtrabend: “Gesellschaft ist ein soziales Gebilde ... “ Wissen wir es jetzt? Sozialisten vielleicht; Liberale noch lange nicht. Zusammenfassung Lebt eine Gruppe von Individuen in sozialer Sichtweite, gar zusammen, besteht ein Kollektiv. Gemeinsames Wissen konstituiert eine (die) Gesellschaft, ein Phänomen der Informationswissenschaft (1) auf Basis natürlicher Intelligenz (NI) Liberale starten mit der Sicht des Individuums. Jedes Individuum hat seit seiner Geburt gelernt, kann sich dem gar nicht entziehen. Mal lernt das Individuum mehr, mal lernt das Individuum weniger. Unbedingt unentwegt. Was, Komplexes, lernt, also weiß, u.a. das Individuum:
Über die Frage ob etwa “Lesen” unter Kulturtechnik
oder Verfahrenswissen zu klassifizieren ist, kann, muss aber nicht gestritten werden. Eben so wenig, ob “gefährliche afrikanische Tiere” Erfahrungs- oder Faktenwissen ist. Die zehn o.a. Wissensklassen überschneiden
sich, gehen ineinander über. Jedenfalls lernen Individuen lebenslang; übrigens ohne, dass Es wird klar, dass dem Individuum - weiter gehend als (angeblich) Sokrates meinte - jeweils aktuell sein so umfangreiches Wissens-Inventar nicht bewusst sein kann, das Individuum also erst recht wenig Kenntnis über das Wissen Anderer erlangen kann. Erst recht im Kollektiv müssen sich alle Individuen damit begnügen, nur partielle Kenntnis über das Wissen des je anderen Einzelnen zu erlangen. Das gilt sogar für Individuen, die in der arbeitsteiligen Gesellschaft funktionsgemäß über das Wissen Anderer Kenntnis zu erlangen haben (2). Schließlich sind Instinkte, “verdrahtetes Wissen”, das Verhalten beeinflussend, beim Individuum gespeichert. Denkbar, dass gelerntes Wissen Instinkte verstärkt od. abschwächt. Fazit: Individuen mit komplexem, meist zunehmendem, qualitativ und quantitativ unterschiedlichem Wissen ausgestattet, treten gesteuert durch ihr Wissen in Beziehung, erlangen deswegen inter-individuell (weiteres) gemeinsames Wissen. Jede Gesellschaft wird (prinzipiell !) durch Information konfiguriert, bestimmt und definiert. Das gesellschaftliche Informations-Netz “In-Beziehung-Treten” sind Prozesse individuellen Verhaltens. Sie beruhen - von natürlicher Intelligenz verarbeitet - neben den Instinkten auf gelerntem Wissen der Beziehungspartner. Anderes Wissen bewirkt anderes Verhalten. Umgekehrt formuliert, ist Verhalten Konsequenz / Ausdruck von bestimmtem Wissen. Biologisch gleiche Konfiguration der Individuen (Gattung) gar der Weltgesellschaft (zunächst unkritisch, gleichwohl folgerichtig) unterstellt, rücken Wissen und Unwissen in das Zentrum der Soziologie, eine Wissenschaft, deren Sujet angesichts des inter-individuell weitgehend identischen biologischen Substrates nur informationstechnisch definiert werden kann. Das Gewicht des inter-individuell unterschiedlich intensiven, unterschiedlich umfänglichen und auf den Zeitpunkt bezogenen Wissen muss - anders als die biologisch- organische Hülle des Individuums - überwältigend, gar nahe 100% bei der (Konfiguration der soziologisch orientierten) Definition des Begriffes “Gesellschaft” wiegen. Die Weiterungen dieser Aussagen sprengt den Rahmen der LN. Vier erste, simple Informations-Netz-Relationen Es seien die Individuen, Im, einer Gesamtheit von n Individuen, die zum Zeitpunkt, z, jeweils über das Wissen Wmz verfügen. Das Gesamt-Wissen, Gz, aller n Individuen, Im, und das eine Gesellschaft konstituierende Wissen, KGz, lassen sich - vereinfacht - folgende Relationen ausdrücken: (A) Gz = ∪(Im∪Wmz) (B) KGz = ∩ (Im∪Wmz) mit offenkundig (C) KGz << Gz Wissen die Individuen nichts von bzw. übereinander, d.h., KG = ∅, besteht eine Gesellschaft unter ihnen nicht. Präzisere Aussagen siehe (5) Exkurs. Die Individuen handeln (untereinander) mit der Folge, dass Beziehungen gestützt auf gemeinsames Wissen entstehen. Eine Gesellschaft besteht, wenn die inter-individuelle Schnittmenge an Wissen die Schwelle, S, überschreitet. (D) ∅ < S < KG z << Gz Zu gemeinsamen Wissen, d.h., die inter-individuell jede Gesellschaft erst konstituierende Wissens-Schnittmenge gehören aus den o.a. 10 Wissens-Klassen diese Kategorien
Geringes KG etwa im gemeinsamen Staat der betrachteten Menge von Individuen erzeugt Probleme, wobei der Fall KG < S als “gescheiterte (verfallene) Gesellschaft” zu kennzeichnen ist. Offen bleibt hier, ob S für die Bildung (3) Gesellschaft od. für die Bildung (3) Staat anspruchsvoller ist. Die Rolle des Herrschenden und die Bedeutung von Herrschaftswissen lassen sich vor dem Hintergrund dieser Überlegungen besser erklären. Erneut, wie zuvor: Präzisere Aussagen siehe (5) Exkurs. Die vorstehenden vier Informations-Netz-Relationen (A)-(D) sind (bisher) in dem Sinne nicht operational, als daraus Maßnahmen nicht abzuleiten sind. Der Einsatz des Wortes “Gesellschaft” oder die Überlegungen zu sozialen, politischen, usw. Prozessen haben diese Relationen den Vorteil, dass sich aufschlussreiche weitergehende Einsichten ergeben. Vor allem die irreführende grammatikalische Personalisierung, regelmäßig folgenschwerer Kategorienfehler, (u.a.) der Worte “Gesellschaft”, “Staat”, “Kapital”, “Sozialismus” wird als absurdes Verhalten der Kommunikation besser bewusst. Ob sich die Gemeinschaft der Soziologen an das entscheidende Sujet, nämlich die, der jede Gesellschaft konstituierende Wissens-Schwelle heranwagt? Bisher sind die Wissensträger der Soziologie-Disziplin in Meta- Aussagen hängen geblieben und unterliegen häufig dem Fehler, empirisch gewonnenes Wissen “wie selbstverständlich” - ohne das Prinzip der sozialwissenschaftlichen Unschärfe gebührend zu beachten (4) - unzulässig zu verallgemeinern.
Erweiternde Zusammenfassung und Definition:
Werden, etwa im Rahmen politischer Aktivität, daraus vernünftige Konzequenzen gezogen? Was ist hierzu als “Gestaltung von oben” überhaupt machbar? -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- (5) Exkurs: seien g i,j >
∅ das gemeinsame Wissen, iiWB die ”interpersonellen (informatorischen) Wissens-Brücken”, der Individuen i und j. |
|
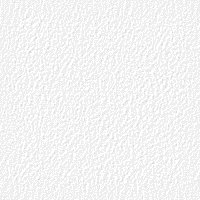 |